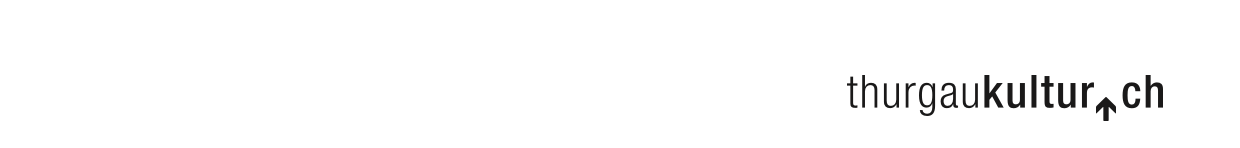von Jeremias Heppeler, 23.04.2020
In die Wildnis

„Lebe wild und gefährlich“ klingt in der Corona-Zeit wie ein überholtes Lebensmotto. Was bedeutet es heute überhaupt, wild zu sein? Ein Essay über das Wilde in uns allen.
Das neue Portal www.thurgau.wildenachbarn.ch ist wirklich fantastisch. Das vom Kanton geförderte Projekt gibt nicht nur einen Überblick über die heimische Flora und Fauna, sondern lädt ganz explizit zum Mitmachen ein. Der geneigte Tierdetektiv ist dazu angehalten, seine Tierbeobachtungen zu archivieren und zu melden und damit seinen Beitrag zu leisten, einen detaillierten Überblick über die Tierwelt im Thurgau zu gewinnen.
So heisst es auf der Homepage: „Nur was ich kenne, kann ich auch schützen”. Deshalb an dieser Stelle und bevor der eigentliche Text überhaupt los geht: Geht raus, schnappt Handys und Fotoapparate, leiht euch Kamerafallen aus, macht euch auf die Pirsch und spürt ausnahmsweise ohne schlechtes Gewissen euren wilden Nachbarn nach.
Verklebte Versformen, immer gleiche Rittergeschichten
Wir aber forschen jetzt erst einmal in eine andere Richtung. Unser Wald heisst Sprache. Klingt langweilig? Abwarten! Denn wir haben ein ungewöhnliches Zielobjekt. Es ist ein Wort. Aber nicht irgendein Wort. Sondern so eines, das seine Bedeutung über die Jahrhunderte der Begriffsgeschichte stetig veränderte, das sich allen Zugriffen entzog und sich doch immer wieder in einen roten Faden wickelte.
Ein Wort, das bereits in der Literatur des Mittelalters eine spannende Rolle spielte und dem heute sogar von Rapstars Kultstatus verliehen wurde. Doch reden wir nicht lange um den heissen Wortbrei herum. Es geht um: die Wildheit.
Bereits auf allererster Ebene ist das Wort „wild” schon so ein fabelhaftes Gebilde. Irgendwie eigenwillig, ein wenig grotesk, so vielfältig aufgeladen und doch zurückhaltend und klar. Bereits Grimms Wörterbuch bescheinigte dem Wort „wild” eine ganz „erstaunliche vielseitigkeit”. Was also bedeutet es überhaupt, wild zu sein?

Wolfram von Eschenbach, der Literaturrockstar des Mittelalters
Wie sooft finden wir die ersten konkreten Verästelungen des übergeordneten Diskurs im höfischen Roman. Die Autoren des Mittelalters mögen uns heute ein wenig altbacken und angestaubt vorkommen mit ihren immergleichen Rittergeschichten, den nie endenden Topoi, der verklebten Versform und dem hochgestochenen Mittelhochdeutsch. Aber: Diese Autoren waren echte Pioniere. Es gab abseits des eigenen Genre keine Genres und keine Genreegeln, es gab nichts zu zitieren, nichts als weisse Blätter, wohin das Auge reichte.
Der wildeste Autor des Mittelalters, ein waschechter Literaturrockstar, in einer Blutlinie mit Autoren wie Herman Melville, Thomas Pynchon oder Walter Moers, war Wolfram von Eschenbach. Wolfram verschob und dehnte die Regeln des Erzählens, schrubbte poetologisch durch die von ihm selbst entworfenen Welten, kommentierte witzig und ironisch durch teilweise hoch diffizile semantische Problemfelder.
Alles-auf-den-Kopf stellen als Prinzip
Mit dem Substantiv „wilde” umschrieb die Literatur des Mittelalters von allem den nicht kultivierten Raum - und damit recht konkret alles nicht-höfische. Christliche Welt vs. vor-zivilisierte Welt. Jenen Raum also, durch den es die Heldenfiguren im Zuge ihrer „Âventiure”, der gefahrvollen Bewährungsprobe, beinahe zwangsläufig hindurch trieb. Wolfram wäre allerdings nicht Wolfram, würde er diesen Umstand nicht konsequent auf den Kopf stellen.
In seinem Opus Magnum „Parzival” ergeht es dem gleichnamigen Helden also wie folgt: Parzival wird als Sohn von Gahmuret und Herzeloyde in den absoluten Hochadel geboren. Als sein Vater im Zuge des typischen Ritterdaseins stirbt, entschliesst sich Parzivals Mutter, den Hof zu verlassen und in den Wald, ins „wilde” zu ziehen.
Dort, in der vollkommenen Isolation, fernab aller Kriege, Monster und tödlichen Gefahren wächst der kleine Parzival ohne Kenntnis seiner Herkunft auf. Und hier beginnt die Wolfram-typische Doppelung: Die wilde Welt fungiert plötzlich als regelrechter Schutzraum, während das höfische sich vor allem durch allgegenwärtige Gefahren für einen angehenden Helden auszeichnet.
Parzival und seine gespaltene Herkunft
Selbstverständlich gilt auch hier der weit verbreitete Leitsatz: Du bekommst den Ritter aus dem Hof, aber den Hof nicht aus dem Ritter - und so zieht es Parzival beinahe magnetisch zurück in die Ritterwelt, wo seine gespaltene Herkunft schnell zum Markenzeichen wird, das ihn in ein Fettnäpfchen nach dem anderen tunkt und ihn positiv wie negativ von seinen Konkurrenten abhebt. Parzival, daran lässt der Roman keine Zweifel, bleibt ein Narr. Der Gang in die Wildnis wird innerhalb der gängigen Topoi als Fehler deklariert - der Roman selbst gewinnt aber an unzähligen Vielschichten.
Das Wilde als Sehnsuchtsort
Das Wilde also erscheint uns bereits in frühesten Literaturformen als ambivalenter Raum. Einerseits als gefährlich und unberechenbar, als Raum abseits der menschgemachten, der sicheren Kultur. Andererseits als in sich geschlossener Gegenentwurf, als Sehnsuchtsort.
Zwischen diesen beiden Polen schlägt die semantische Nadel bis heute aus. Besagte Sehnsucht ist aber in den seltensten Fällen friedlicher Natur, immer aber ein Blick in die Vergangenheit. Abseits der Hochkultur, die im Mittelalter ja nur den allerwenigsten zugänglich war, entwickelten sich bunt gefächerte Traditionen der Darstellung von Wildheit in den unterschiedlichsten Kulturen und Bräuchen.
Die Figur des wilden Mannes
Am prägnantesten zeigt sich dieser Umstand sicherlich in der Figur des „wilden Mannes”, die sich praktisch im gesamten Europa nachweisen lässt - und von dem Fotografen Charles Fréger auf einzigartige Art und Weise eingefangen wurde.
Der wilde Mann ist ein anthropomorphes Wesen, verwurzelt im Aber- und Volksglaube des späten Mittelalters, eine Figur aus dem Wald, vielleicht auch der Wald selbst, eine direkte Metapher jedenfalls für die ungezähmte Natur an sich, aber zähmbar, fähig zu Zivilisation und Erlösung.

«Die Maske hilft dir nicht dabei, ein anderer zu werden, sondern gibt dir die Freiheit, du selbst zu sein.»
Jeremias Heppeler (Bild: Jeremias Heppeler)
Aus dieser mythologischen Figur entwickelten weit verzweigte und feinst verästelte Bräuche des Verkleidens, der Tierwerdung, die sich bis heute vor allem in Advents- und Fastnachtsbräuchen halten. Die Gesellschaft wird zumindest temporär an der Fastnacht auf den Kopf gestellt. Wildheit, jetzt gleichgesetzt der Freiheit des Allesaufdenkopfstellens, übernimmt, diktiert das System, sprengt die Regeln. Wichtig und entscheidend: Die Maske hilft dir nicht dabei, ein anderer zu werden, sondern gibt dir die Freiheit, du selbst zu sein. Das Wilde steckt in jedem von uns.
Doch nichts und niemand treibt uns Menschen mehr um, als unsere eigenen unterdrückten Sehnsüchte und Ängste. So nimmt es nicht Wunder, dass im Zuge der Sünden des Kolonialismus das Wilde plötzlich zum rassistischen Unwort reifte.
Und plötzlich: Ein rassistisches Unwort
Egal ob in Afrika, in Amerika oder Australien, überall wo westliche Entdecker auf Urvölker trafen, wurden diese als „Wilde” bezeichnet. Gemeint war damit: minderwertig. Rückständig. Wild wurde zum sortierenden Begriff, eine Tradition, die sich später auch in der aufkeimenden Psychoanalyse wiederfand und dem Diskursfeld „Kultur” direkt gegenübergestellt wurde. Anstatt sich auf Augenhöhe zu begegnen, voneinander in einem Austausch auf Augenhöhe zu lernen, nutzte der Kolonialismus den eigenen technischen Vorsprung, um Unterdrückungsmechanismen in Gang zu setzen, die bis heute anhalten.
Der vermeintlich kultivierte Mensch zeigte sich im Übrigen immer dann als besonders unkultiviert, wenn es darum ging, die eigene Kultur vor EInflüssen von aussen, sprich dem Wilden, zu schützen.
Die Überwucherung des Katastrophenortes Tschernobyl
Schrittchenweise gelang es in den vergangenen Jahrzehnte, das wunderbare Wort „wild” wieder mit positiver Bedeutung aufzuladen. Nach einem Jahrhundert der erbarmungslosen Naturzerstörung durch den Menschen häuften sich zuletzt Meldungen, in denen das Wilde den Kulturraum für sich zurückeroberte.
Das merkwürdigste Beispiel ist sicherlich das Kernkraftwerk Tschernobyl, das mittlerweile von einer regen Tier- und Pflanzenwelt überwuchert scheint. Bären, Wölfe und Luchse finden den Weg zurück nach Mitteleuropa. Und innerhalb aller Schreckensmeldungen um die Corona-Krise (selbst so ein Marker der ungezähmten Natur) gab es kompakte Feelgood-Storys aus Venedig, nach denen das zuvor völlig verdreckte Wasser in Abwesenheit des Schiffsverkehrs urplötzlich den Blick auf Fische freigab. Die ebenso verbreitete Meldung von angeblich in den städtischen Kanälen sich tummelnden Delfinen wurde inzwischen allerdings als Fake entlarvt.
„Alles ist gut, so lange du wild bist“
Innerhalb der Jugendsprache (die sich meist recht direkt im HipHop bedient) hat das Adjektiv „wild” oder auch „zu wild” längst Wortrenter wie cool oder krass abgelöst - und knüpft damit an bestehende Zuschreibungen aus der Jugendkultur der 60er und 70er Jahre an: Wildfang! The wild one. Und auch für Kids gilt wild nicht mehr als komplett abzulehnende Verhaltensweise, sondern als durchaus erstrebenswerte Charaktereigenschaft. So lautet das Motto der extrem erfolgreichen Serie „Die wilden Fussball-Kerle”: „Alles ist gut, solange du wild bist”.
Ein wunderbar griffiges Bild hierfür zeichnet das Kinderbuch „Wo die wilden Kerle wohnen” von Maurice Sendak (kongenial verfilmt von Spike Jonze), in welchem der kindliche Protagonist Max in seinem Wolfskostüm derartig umtreibt, dass ihn seine Mutter ohne Essen ins Bett schickt - der Schlafplatz aber wird zum Portal in die Welt der wilden Kerle und Max im Handumdrehen ihr König. Erst als wilder Kerl lernt, er eine Menge über Freundschaft, über Moral, über Familie und über sich selbst.
Und so schliessen wir mit einem Zitat, das fälschlicherweise Artur Schnitzler zugeschrieben wurde: „Du fragst mich, was soll ich tun? Und ich sage: Lebe wild und gefährlich.”

Weitere Beiträge von Jeremias Heppeler
- „Der Thurgau ist ein hartes Pflaster!“ (08.07.2024)
- Sehenden Auges in den Sturm (08.05.2023)
- Die Superkraft der Literatur (17.04.2023)
- Auf zu neuen Welten! (27.03.2023)
- Die Tücken der Vielfalt (15.12.2022)
Kommt vor in diesen Ressorts
- Wissen
Kommt vor in diesen Interessen
- Essay
- Belletristik
- Lyrik
- Natur
Ähnliche Beiträge
Mit Monty ins Museum
Informativ und lustig: Das Naturmuseum Thurgau und die Theaterwerkstatt Gleis 5 haben zusammen einen neuen Hörspaziergang und eine Schnitzeljagd entwickelt. Das macht nicht nur Kindern Spass. mehr
Wie der Wein an den Bodensee kam
Zum Themenjahr «Wein am Bodensee 2025» markiert das Museum für Archäologie Thurgau mit der Ausstellung «Bacchus & Co. – Wein am Bodensee» den Auftakt zu einer ganzen Ausstellungsreihe. mehr
Wie tickt unsere biologische Uhr?
Ob Fledermäuse, Pflanzen, Insekten oder Menschen, alle haben den 24-stündigen Tag-Nacht-Rhythmus verinnerlicht. Das Gewerbemuseum Winterthur spürt dem nach. mehr