von Jeremias Heppeler, 11.09.2025
Künstler jenseits von Schubladen

Neon, Rubbellose und ein Soundtrack wie aus „Twin Peaks“: Tobias Rüetschis „Grubby Fingers“ zeigt, warum Games längst Hochkultur sind. (Lesedauer: ca. 5 Minuten)
Tobias Rüetschi ist wohl der Albtraum eines jeden konservativen Galeristen. Nicht, weil er einen schwierigen Charakter hat, ganz im Gegenteil. Aber das Werk des aus Frauenfeld stammenden Künstlers lässt sich unmöglich mit einem cleanen Marketingsatz zusammenfassen. Es entzieht sich. Ständig. Der Welt. Und auch sich selbst.
Rüetschi ist zuvorderst Musiker in verschiedenen Bandkonstellationen, aber auch als Solo-Artist. Er experimentiert. Immer. Meist in digitalen Sphären und mit Ästhetiken, die sich irgendwie im Internet verankern. Er ist ein Umalleeckendenker.
Vom Musiker zum Game-Entwickler
Folgerichtig bewegt er sich auch immer wieder im Umfeld eines Mediums, das längst die Weltherrschaft übernommen hat, das wir Kulturjournalisten aber beinahe sträflich vernachlässigen: Games. Vor einigen Wochen hat Rüetschi sein nunmehr drittes offizielles Computerspiel herausgebracht. Und das hat es in sich: „Grubby Fingers“ ist auf erster Ebene ein hübscher Rubbellos-Simulator, aber eben auch so viel mehr. Aber springen wir doch direkt rein in die Pixelwelten.
„Grubby Fingers“ ist keinesfalls eine seichte Fingerübung, sondern ein komplexes, vielschichtiges Spielerlebnis, das seine Spieler und Spielerinnen auf vielfältige Arten und Weisen stimuliert und herausfordert. Zuerst ist da die ansprechende Optik: Wir befinden uns in einer in Neonfarben ausgeleuchteten Raststätte, deren dezent mysteriöser Look unheimlich zur Atmosphäre beiträgt. Per klassischer Point-and-Click-Steuerung manövrieren wir uns durch zielgerichtete Mausklicks durch diesen Mikrokosmos.

Die Diskussion, ob Games auch Kulturgut sind, dauert schon lange. Wie blickt Tobias Rüetschi darauf?
Tobias, warum, denkst du, werden Games, das mit Abstand erfolgreichste Popkultur-„Genre“, immer noch – und speziell von der Hochkultur – belächelt?
„Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Einerseits sind Games über die letzten Jahrzehnte zu einer riesigen Szene geworden die auch eigene Erwartungen mit sich bringt. Plattformen wie Steam haben das stark geprägt: Ein Spiel muss heute bestimmte Kriterien erfüllen, um überhaupt gesehen (und gekauft) zu werden, und das führt fast automatisch zur Reproduktion von Klischees statt zu deren Infragestellung.
Das Stigma entsteht auch dadurch, dass die Branche stark von Männern geprägt ist und sich oft als „unpolitisch“ bezeichnet, meist aber mit klar rechtem Einschlag. Dazu kommt die lange Liste an Skandalen rund um toxische Firmenkulturen und sexuellen Missbrauch. Wenn das sichtbar wird, prägt es natürlich auch das Bild von Games nach aussen. Auf der anderen Seite sehe ich die Indie-Szene als starken Gegenpol, wo Diversität, politische Inhalte und experimentelle Mechaniken selbstverständlich dazugehören.
Eher düster finde ich die Perspektive mit KI: Googles DeepMind hat kürzlich „Genie“ vorgestellt, ein 3D-Welt-Generationsmodell, das aus Text oder Bildern interaktive Umgebungen baut. Klingt spannend, aber die Gefahr liegt für mich auf der Hand: KI reproduziert genau die Klischees, auf denen sie trainiert wurde. Wenn man also nicht bewusst neue Impulse setzt, besteht das Risiko, dass Games noch stärker in einer Endlosschleife aus denselben Mustern hängenbleiben. Die Gefahr ist natürlich für alle Kunstformen da, KI-Generation darf da aus extrem vielen Gründen nicht zum neuen Standard werden.“
Kindheitserinnerungen an „Myst“ und „Monkey Island“
Tatsächlich ist Tobias Rüetschi Fan dieser besonderen Art der Rätselspiele:
„Den grössten Einfluss hatten wohl Spiele aus meiner Kindheit. Ich habe oft meinen Eltern beim Spielen von Point-and-Click-Adventures wie Myst oder Riven zugeschaut. Die Atmosphäre hat mich fasziniert. Die ganze Reihe habe ich mit meiner Familie durchgespielt. Dazu kamen auch weitere Adventure-Spiele wie zum Beispiel Monkey Island oder andere LucasArts-Spiele. Was mir schon immer gefallen hat, war der soziale Aspekt des Gamens: zusammen an einem Computer zu sitzen und an Rätseln zu tüfteln, auch mal steckenzubleiben und die ganze Erfahrung zu besprechen, selbst wenn das Spiel schon wieder abgeschaltet war.“
Mechaniken zwischen Glücksspiel und Strategie
„Grubby Fingers“ offenbart uns nach ein wenig Erkunden vier mögliche Handlungsmanöver: Da ist ein Kühlschrank voll mit Energydrinks, in die wir unsere 20 Dollar Startkapital investieren können, ein Radio, welches wir anwerfen dürfen, ein Schaukasten mit zahlreichen Rubbellosen und ein passender Tisch zum energetisch Freirubbeln.
Das Geniale an „Grubby Fingers“ ist die Art und Weise, wie das Spiel seine reduzierten Mechaniken erklärt, ohne den Spielern und Spielerinnen detaillierte Erklärungen aufzuzwingen. So macht jeder seine eigenen Erfahrungen mit dem Spiel, entwickelt Taktiken und baut seine eigene, losgelöste Erfahrung.
„Grubby Fingers“ ist natürlich kein Blockbuster-Spiel, aber durch seine ausgeklügelte Indie-Mechanik ergibt sich ein unheimlich motivierendes Gaming-Erlebnis, das sowohl den Entdecker:innen-Geist kitzelt als auch die intrinsische Motivation nach dem höchsten Highscore mitdenkt.

Die Musik als Twin-Peaks-Soundtrack
Für den Solo-Entwickler war es aber trotzdem eine Menge Arbeit, eine Welt wie diese zu generieren:
„Es war superaufwendig! Ich habe oft den Anspruch, alles selbst zu machen. Das heisst: Für dieses Spiel habe ich zuerst alle 3D-Models selbst in Blender erstellt, dann mir einen Weg ausgedacht, einen algorithmisch generierten Soundtrack zu integrieren, alle Samples selbst aufgenommen und schliesslich das ganze Spiel in der Open-Source-Engine Godot programmiert. Das hat etwa fünf Jahre gedauert, da ich dieses Projekt eher als Hobby verfolgt habe.“
Natürlich müssen wir über die Musik sprechen: Es ist schon ein Segen, wenn der Entwickler des Spiels parallel auch noch als Musiker arbeitet. Die Musik des Spiels ist herausragend und trägt massgeblich zum Twin-Peaks-Ambiente der Raststätte bei, die alleine durch die vielschichtige Audioebene, die scheinbar auf die gespielten Aktionen reagiert, von Zeit zu Zeit ziemlich gruselig erscheinen kann.
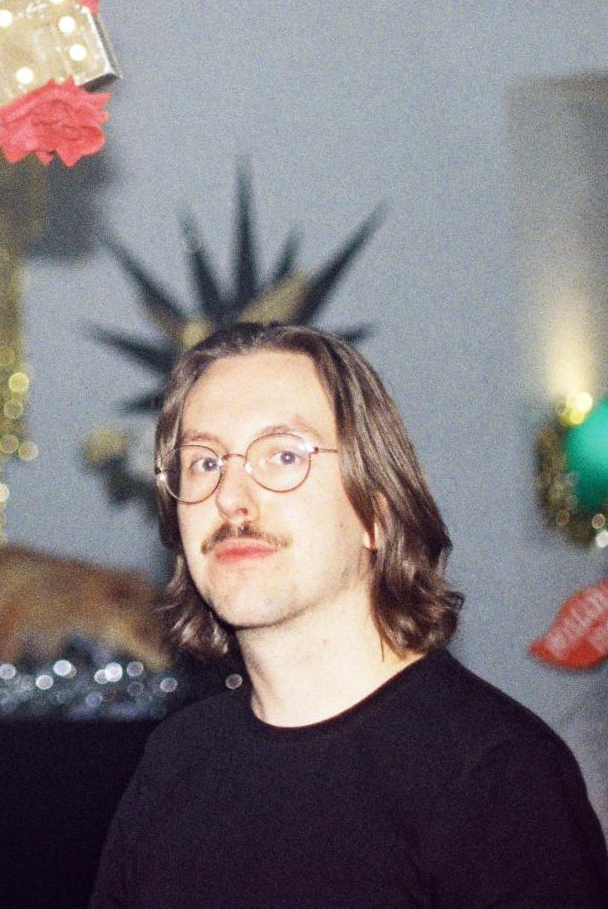
Games als Kunst – und kritische Gesellschaftsanalyse
Am Ende zeigt uns dieses kleine Spiel eben auch, warum wir Games längst auch als Kunst verstehen sollten: Innerhalb einer aufs Nötigste reduzierten Konstellation erzählt „Grubby Fingers“ nicht nur davon, wie es sich anfühlt, mitten in der Nacht in eine Raststätte zu stolpern, sondern weckt dabei Kindheitserinnerungen an Rubbellose und den Spieltrieb gleich mit.
Wenn man sich dann aber selbst dabei erwischt, wie man seine letzten Groschen zusammenzählt, nur um noch mal alles auf die letzte Chance zu setzen, dann fühlt man sich doch regelrecht ertappt beim Abrutschen in einen Glücksspielkreislauf, der – wie gerade erwähnt – alleine durch die Musik durchaus tiefschürfende Abgründe mitdenkt – was für Rüetschi nicht zuletzt ein poetologisches Nachsinnen über das Medium Computerspiele an sich hervorrief:
„Mein Konzept war eine kritische Auseinandersetzung mit einer Grundmechanik des Videospiels: Wenn man Mainstream-Spiele auf das wesentliche Gameplay herunterkocht und das Gerüst anschaut, zeigt sich da oftmals das simple Konzept von number goes up. Das scheint etwas zu haben, das Spieler:innen motiviert, dranzubleiben. Spieler:innen erarbeiten sich Punkte durch schnelle Reaktion, durch Strategie oder durch Glück und das pure Aufopfern von Zeit. Mein Spiel erforscht und übertreibt die dritte Möglichkeit. Auch hier zeigt sich eine düstere Seite der Videospiele, denn da greifen dieselben Mechaniken wie beim Glücksspiel. Statt Geld spielen wir aber (zumindest meistens) mit unserer Zeit und werden mit Realitätsflucht und Endorphinen belohnt.“

Und hier wird überdeutlich: Rüetschi hat kein oberflächliches Spiel kreiert. „Grubby Fingers“ ist ein Kunstwerk, das sich die Mechaniken des Mediums zu eigen macht, um ganz andere Dinge anzusprechen und aufzuwirbeln. Aber warum Rubbellose?
„Auf die Idee mit den Lotterielosen kam ich, als ich mich mit den Hintergründen der Kulturförderung durch Lotteriefonds befasst habe. Es gibt Studien, die sich kritisch mit diesem System auseinandersetzen und zeigen, dass Rubbellose und andere Formen der Lotterie eigentlich nur von der ökonomisch schwächsten Gesellschaftsgruppe genutzt werden, mit dem leeren Versprechen des Klassenaufstiegs. Das Geld wird dann genutzt, um Kultur-, Sport- und Wohlfahrtsprojekte zu unterstützen, die eigentlich nur für die Mittel- bis Oberschicht zugänglich sind. Wenn man also genauer darüber nachdenkt, wofür so ein winziges Lotterielos steht, wird es schnell absurd. Viele Künstler:innen sind aber mangels Einkommen für die Fertigstellung von Projekten abhängig von Beiträgen aus dem Lotteriefonds, und auch ich konnte schon davon profitieren. Aber irgendwie hat mich die Tatsache der gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit dieses komischen Systems nicht losgelassen, und das ist dann zur Hauptmechanik dieses Spiels geworden.“
Erste Reaktionen: Faszination und kalter Schauer
Für den Entwickler gab es einen besonderen Moment, als er auf dem Festival Fantoche beim dortigen Game-Pop-up einen seiner ersten Spieler beobachtete, der sein Spiel plötzlich wie besessen über Stunden spielte: „Als ich gesehen habe, wie gut diese simple Mechanik funktioniert, und Menschen ans Spiel zu fesseln, ist's mir auch ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen, haha. So à la: Was habe ich da erschaffen?“
Am Ende des Spiels verlassen wir die Raststätte (was es dafür braucht und welche Geheimnisse das Spiel noch für euch bereithält, das müsst ihr schon selbst herausfinden) und die Schwärze der Nacht, die gleichermassen den Anfang und das Ende der Spielwelt absteckt, umweht unsere stummen Avatare als verpixeltes Möglichkeitsrauschen. Eine besondere Erfahrung.
Wer es selbst ausprobieren möchte: „Grubby Fingers“ gibt es hier und hier.

Weitere Beiträge von Jeremias Heppeler
- Die lyrische Urgewalt des Punkrock (08.10.2025)
- Heldenreise im Kopfhörer (23.09.2025)
- „Der Thurgau ist ein hartes Pflaster!“ (08.07.2024)
- Sehenden Auges in den Sturm (08.05.2023)
- Die Superkraft der Literatur (17.04.2023)
Kommt vor in diesen Ressorts
- Kunst
Kommt vor in diesen Interessen
- Porträt
- Digital
- Medien
Ähnliche Beiträge
„Das Menschliche verliert mehr und mehr an Bedeutung“
In Zeiten von KI und digitaler Bilderflut setzt die Künstlerin Cornelia Schedler auf analoge Drucktechniken. Seit sie eine Druckerei geerbt hatte, investiert sie viel Zeit und Energie in jedes Werk. mehr
Der Spurensucher
Othmar Eder erhält am Mittwoch den Thurgauer Kulturpreis. In seinem Werk verbinden sich Vielfältigkeit und Beharrlichkeit. Wenige haben einen so genauen Blick wie er. Eine Begegnung. mehr
Zeit des Erwachens
Beim „Heimspiel“ berührte Mirijam Špendov mit einer sensiblen wie klugen Arbeit über Erinnerungen. Folgt jetzt ihr Durchbruch als Künstlerin? Ein Atelierbesuch bei einer bemerkenswerten Frau. mehr













