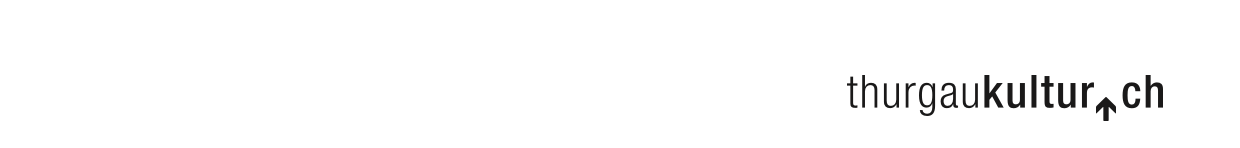von Michael Lünstroth・Redaktionsleiter, 03.12.2018
Wenn Ökonomen Kunst erklären
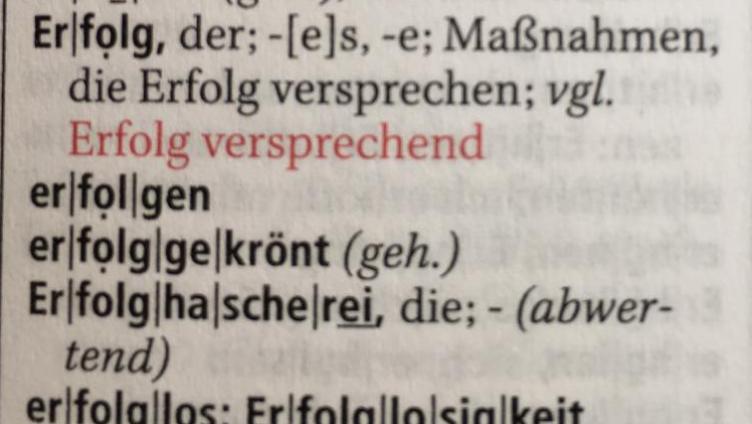
Erfolg auf dem Kunstmarkt hängt nicht vom Talent, sondern vom eigenen Netzwerk ab. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Ökonomen Magnus Resch. Was man daraus lernen sollte.
In der Schule früher war das oft so: Wie beliebt man war, hing auch davon ab, mit wem man so abhing. Das eigene Netzwerk entschied mit darüber, auf welcher Stufe der Popularitätsskala man sich gerade befand. Der Kunstmarkt funktioniert heute ganz genau so. Das zumindest behauptet Magnus Resch. Der Ökonom, Unternehmer und Erfinder der Kunst-Erkennungs-App „Magnus“ hat mit Wissenschaftlern die Karrieren von einer halben Million Künstlerinnen und Künstlern untersucht (die komplette Studie ist im Fachmagazin «Science» erschienen). Sein Fazit: «Ein paar Kuratoren, Galeristen, Museumsdirektoren und reiche Sammler bestimmen, was gute Kunst ist», sagte er im Gespräch mit dem Monopol-Magazin. Ohne Netzwerk sei es nicht möglich, den Wert von Kunstwerken festzulegen. Deshalb komme diesem Netz, das Künstlerinnen und Künstler um sich spinnen (lassen), so eine immense Bedeutung zu.
Ernüchternd: Nur wer in Top-Institutionen ausstellt hat Erfolgschancen
Dabei kommt es zudem darauf an, nicht in irgendeinem Netzwerk zu sein. Wer richtig Erfolg haben will, der brauche, so Resch, das richtige Netzwerk: «Es ist ein Irrglaube zu meinen, dass erfolgreiche Künstler besonders talentiert sind. Erfolgreiche Künstler sind schlichtweg im richtigen Netzwerk», erklärt Magnus Resch. Mit dem richtigen Netzwerk meint er die Top-Institutionen der Kunstwelt wie das MoMA, Guggenheim und Gagosian Gallery, Pace Gallery oder die National Gallery of Art. Nur wer in diesen Sphären verkehrt, habe wirklich Chancen auf eine grosse Karriere heute, sagt Resch. Alle anderen seien ohne grosse Erfolgsaussichten. Seine Daten scheinen das zu belegen: Von den 500.000 Künstlerkarrieren, die er untersucht hat, haben nur 240 Künstler so etwas wie einen Aufstieg geschafft: Sie starteten bei weniger bekannten Institutionen und konnten im Vorlauf ihrer Biografie trotzdem in Top-Institutionen ausstellen. Das erfolgsversprechende Netzwerk ist also extrem undurchlässig. Entweder hat man das Glück drin zu sein, oder eben nicht. Leistung allein bringt einen jedenfalls nicht rein, so eine der bitteren Erkenntnisse von Reschs Untersuchung.
Eine Lehre: Sich nicht vom Marktgetöse überrumpeln lassen
Was lernt man nun daraus? Aussteller wie Publikum könnten daraus lernen, skeptischer bei den üblichen Markthypes zu sein. Sich nicht vom Getöse des Marktes überrumpeln zu lassen, sondern genauer hinzuschauen, wie viel Wert (auch jenseits des ökonomischen) wirklich in einem Kunstwerk steckt. Den Künstlerinnen und Künstlern rät Magnus Resch: «Knallhart am Aufbau seiner eigenen Marke arbeiten und netzwerken, um die richtigen Leute kennenzulernen.» Das sagt sich nun leichter als es ist. Zumal das heftige Klinkenputzen auch nicht jedermanns Sache ist. Und überhaupt: Wenn Künstlerinnen und Künstler am Ende mehr damit beschäftigt sind Kuratoren, Galeristen, Museumsdirektoren und reiche Sammler zu umgarnen als mit dem eigentlichen Kunstprozess - was soll da noch für Kunst entstehen?
Aber Magnus Resch wäre nicht Magnus Resch, hätte er nicht auch da einen Vorschlag. Um mehr Fairnesss und Gleichberechtigung zu erreichen müssten staatliche Museen Künstlern Ausstellungen geben, die nicht von den Top-Galerien kommen: «Das könnte in einem Äquivalent zu ‚Blind Auditions‘ gemacht werden, so wie in amerikanischen Orchestern nicht selten offene Stellen besetzt werden.» Das bedeutet: Die Entscheider hören einen Bewerber, sehen ihn aber nicht. Bekannter wurde dieses Format vor allem durch die Castingshow «The Voice of Germany», in der genau so die Kandidaten ausgewählt werden. Liesse sich solch ein Modell nicht auch auf die Kunst übertragen?
Ein Versuch: «Blind Auditions» bei der Auswahl der Werkschau Thurgau?
Zunächst klingt es komisch, aber das Format hat etwas. Wenn Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, sowie bisheriger Werdegang keine Rolle spielen bei der Entscheidung über Kunstwerke, könnte man den Bewertungsprozess fairer und transparenter machen. Letzteres vor allem dann, wenn auch für das Publikum nachvollziehbar wird, warum einige Kunstwerke ausgewählt wurden, andere aber nicht. Das wäre dann nicht nur ein Gerechtigkeits-, sondern auch ein spannendes Kulturvermittlungsprojekt. Jurys könnten auf kunstwissenschaftlicher Basis erklären, warum sie handeln wie sie handeln. Das ist dann vielleicht für die Künstler, die nicht ausgewählt wurden im Moment unangenehm. Aber wer mehr Transparenz und Gerechtigkeit will, muss auch damit leben, dass öffentlich über seine Arbeiten diskutiert wird.
Zugegeben: Der Aufwand dafür ist gross und das Modell eignet sich vielleicht nicht für jede Ausstellung. Wo es funktionieren könnte: Bei grossen Sammelausstellungen. Wie der Werkschau Thurgau zum Beispiel. Die findet 2019 wieder statt und die Auswahl hat in den vergangenen Jahren bei einigen nicht-ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern für Unmut gesorgt. Führte man ein solches Blind-Audition-Modell hier ein, könnte man diesen Stimmungen entgegnen. Nur mal angenommen: In einer öffentlichen Veranstaltung erklären die Kuratoren anhand einiger Beispiele, warum sie dieses Werk auswählen würden, jenes aber nicht. Was das eine zu Kunst macht, das andere eher nicht. Das würde den ganzen Jurierungsprozess schon im Vorfeld transparenter machen. Zudem wäre das ein höchst spannendes Format, das zu einer grossen Diskussion über und Auseinandersetzung mit Kunst einladen würde. Unabhängig von allem, was eine Künstlerbiografie sonst so mit sich bringt. Konzentriert auf das reine Werk. Ja, ich glaube, ich würde eine solche Veranstaltung besuchen.

Weitere Beiträge von Michael Lünstroth・Redaktionsleiter
- «KI kann nicht, was wir können!» (27.10.2025)
- Nicht meckern, reden! (27.10.2025)
- Der Millionen-Transfer (20.10.2025)
- Der Zauderberg (15.10.2025)
- Der Thurgau bekommt eine Kulturbotschaft (06.10.2025)
Kommt vor in diesen Ressorts
- Kolumne
Kommt vor in diesen Interessen
- Die Dinge der Woche
- Bildende Kunst
Ähnliche Beiträge
Schwenk durchs Leben
Mein Leben als Künstler:in (2): Die Videokünstlerin Sarah Hugentobler zeigt in 1 Minute und 18 Sekunden, womit sie sich gerade beschäftigt. mehr
Was Musik und Malerei verbindet
Mein Leben als Künstler:in (17): Die Malerin Ute Klein über ihren Kipp-Stil und was der Zufall mit ihrer Kunst zu tun hat. mehr
„Meine Arbeit ist wie ein beständiges Intervalltraining“
Mein Leben als Künstler:in (13): Die Malerin Ute Klein über den Unterschied zwischen suchen und ausführen und das ewige Pendeln zwischen Struktur und Rhythmus. mehr